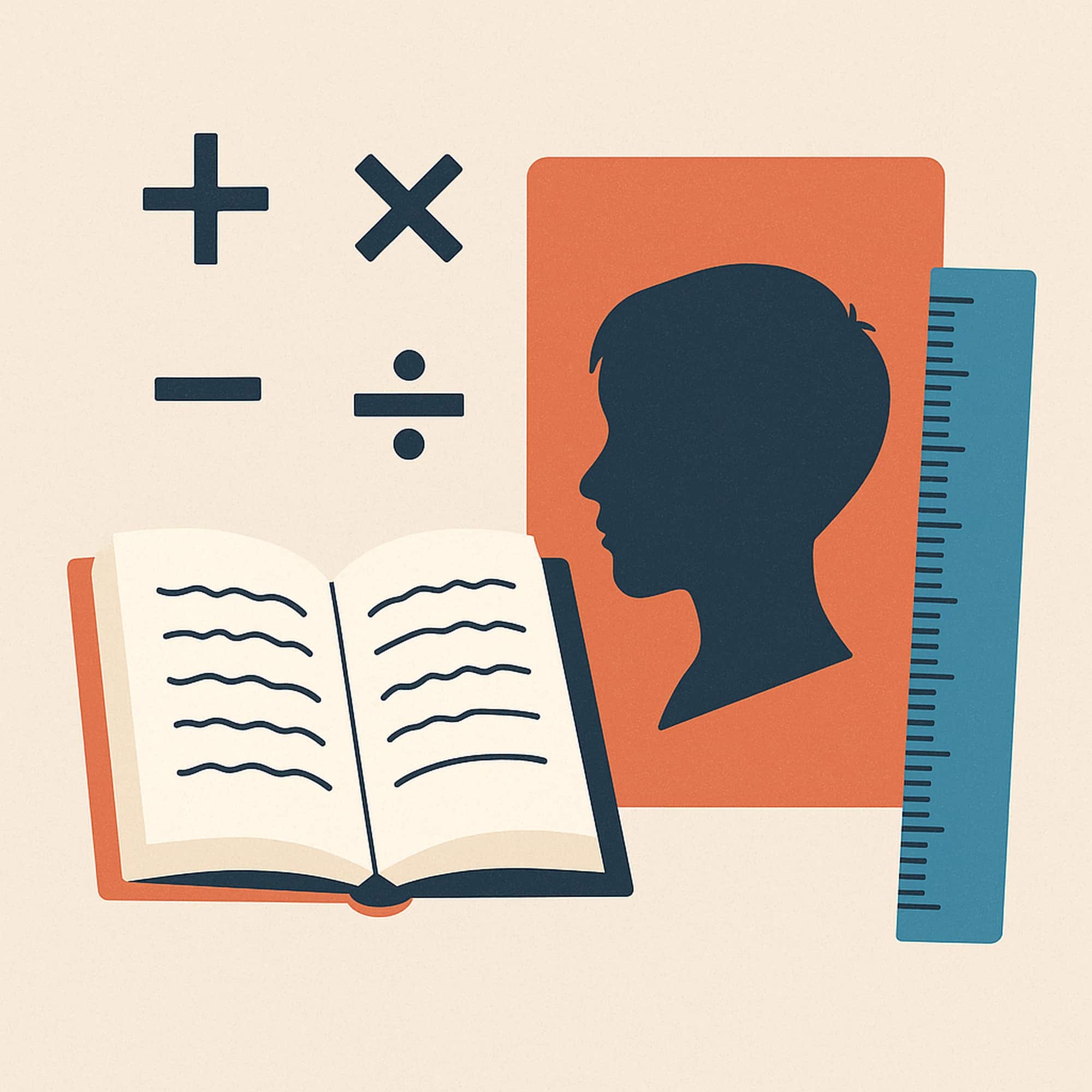30.09.
Tag der Legasthenie und Dyskalkulie: Herkunft, Entwicklung und Bedeutung
Entstehung des Aktionstags
Der Tag der Legasthenie und Dyskalkulie ist ein vergleichsweise neuer Aktionstag, der erstmals am 30. September 2016 begangen wurde. Ins Leben gerufen wurde er vom Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V. (BVL) gemeinsam mit der Deutschen Kinderhilfe, um auf die beiden verbreiteten Lernschwächen – Lese-Rechtschreib-Störung (Legasthenie) und Rechenstörung (Dyskalkulie) – aufmerksam zu machen. Ausschlaggebend für die Einführung dieses Tages war der weiterhin große Unterstützungsbedarf für betroffene Kinder: Schätzungsweise jedes zehnte Kind hat besondere Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. Trotz vorhandener Hilfsangebote war die Situation dieser Kinder im Bildungssystem noch lange nicht zufriedenstellend. Der Aktionstag wurde daher erstmals 2016 ausgerufen, um die schulischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie zu verbessern.
Seit 2016 findet der Tag der Legasthenie und Dyskalkulie jährlich am 30. September statt. Von Beginn an rief der BVL gemeinsam mit der Deutschen Kinderhilfe an diesem Datum zu bundesweiten Aktionen auf. In Pressekonferenzen und Veranstaltungen zur Premiere 2016 wurde deutlich gemacht, dass die Lage der Betroffenen nach wie vor unzureichend ist – unter anderem weil Unterstützungsmaßnahmen in Deutschland stark voneinander abweichen und oft nicht ausreichen. Prominente Betroffene wie der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow bekannten sich öffentlich zu ihrer eigenen Lese-Rechtschreib-Schwäche, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Damit war der Grundstein für einen jährlich wiederkehrenden Aktionstag gelegt, der fortan Ende September fest im Kalender der Bildungseinrichtungen und Interessensverbände verankert ist.
Ziele und Bedeutung des Tages
Der Tag der Legasthenie und Dyskalkulie verfolgt das übergeordnete Ziel, mehr Verständnis, Unterstützung und Chancengleichheit für Menschen mit diesen Lernstörungen zu schaffen. An diesem Tag werden mit bundesweiten Aktionen, Plakaten, Kurzfilmen und Veranstaltungen die Öffentlichkeit und Bildungspolitik informiert. Kinder mit Legasthenie oder Dyskalkulie erhalten eine Stimme, um auf ihre besonderen Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Schulen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler sind aufgerufen, ein Zeichen für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem zu setzen.
Im Fokus stehen insbesondere folgende Anliegen:
- Bewusstsein schaffen: Die breite Öffentlichkeit soll erfahren, was Legasthenie und Dyskalkulie bedeuten und dass betroffene Kinder keine „faulen“ Schüler sind, sondern eine neuronale Entwicklungsstörung haben. Durch Aufklärung soll Vorurteilen und Stigmatisierung entgegengewirkt werden.
- Verständnis und Unterstützung fördern: Mit Informationsmaterialien und Aktionen wird für mehr Verständnis in Schulen, Familien und der Gesellschaft geworben. Lehrkräfte sollen sensibilisiert werden, Eltern ermutigt und Mitschüler aufgeklärt werden, damit ein unterstützendes Umfeld entsteht.
- Politische Verbesserungen anstoßen: Der Tag dient als Plattform, um bildungspolitische Missstände aufzuzeigen – etwa fehlende einheitliche Regeln beim Notenschutz und Nachteilsausgleich – und Veränderungen einzufordern. So wird z.B. auf den „Fördernotstand“ hingewiesen, also den Mangel an ausreichender Förderung und spezialisierten Angeboten in vielen Schulen.
- Betroffene stärken: Kinder und Jugendliche mit Legasthenie/Dyskalkulie sollen erfahren, dass sie nicht allein sind und unterstützt werden. Der Aktionstag zeigt ihnen positive Beispiele, vermittelt Erfolgserlebnisse und soll ihr Selbstwertgefühl stärken.
Die Bedeutung dieses Tages zeigt sich auch in der wachsenden Resonanz: Jedes Jahr kommen neue kreative Aktionen hinzu, die teils auch medial aufgegriffen werden. So stellten etwa 2019 etliche Schulen im Rahmen eines Wettbewerbs innovative Förderkonzepte vor, 2020 beleuchteten Erfahrungsberichte die besonderen Herausforderungen während der Corona-Pandemie. Die offizielle Webseite zum Aktionstag bietet Materialien und eine Ideensammlung, damit möglichst viele lokale Initiativen eigene Beiträge leisten können. Insgesamt hat sich der 30. September als wichtiger Termin etabliert, um das Thema Lernstörungen sichtbar zu machen und dauerhaft mehr Unterstützung für Betroffene zu erreichen.
Initiatoren und unterstützende Organisationen
Hinter dem Aktionstag stehen vor allem der BVL und die Deutsche Kinderhilfe als Initiatoren. Der Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V. ist seit 1974 die zentrale Anlaufstelle in Deutschland für Menschen mit Lese-Rechtschreib- und Rechenstörungen. Gemeinsam mit der Deutschen Kinderhilfe – einer Kinderrechtsorganisation, die als “ständige Kindervertretung” fungiert – koordiniert der BVL die jährlichen Aktivitäten. Die Deutsche Kinderhilfe unterstützt den Bundesverband etwa mit der Kampagne „Bessere Bildungschancen für Kinder mit Legasthenie und/oder Dyskalkulie“, um auf die besondere Situation der betroffenen Kinder hinzuweisen.
Neben den Initiatoren beteiligen sich zahlreiche weitere Akteure am Tag der Legasthenie und Dyskalkulie. Schulen, Lerntherapie-Praxen, Bildungsinitiativen und Elternverbände organisieren vor Ort Veranstaltungen, Infoabende oder Mitmachaktionen. So werden z.B. Schnuppertage für Lerntherapien angeboten, Lehrerfortbildungen durchgeführt oder öffentliche Lesungen veranstaltet. Auch Online gibt es Aktionen: Ein Netzwerk von Lerntherapeut*innen veröffentlichte etwa zum Aktionstag eine Sammlung von Tipps für „bewegtes Lernen“, um mehr Bewegung ins Lernen zu bringen. Dieses breite Engagement zeigt, dass der Aktionstag von der Basis getragen wird – von Lehrkräften und Eltern bis hin zu Fachleuten – und so eine starke gemeinschaftliche Unterstützung für Legastheniker und Dyskalkuliker aufbaut.
Der Aktionstag findet zudem Rückhalt in der Politik. Häufig wenden sich die Verbände rund um den 30. September mit Forderungen an die Bildungspolitik. So suchte der BVL 2022 zum Tag der Legasthenie und Dyskalkulie das Gespräch mit der Kultusministerkonferenz und mahnte dringenden Handlungsbedarf an. In einem offenen Brief forderten BVL und Kinderhilfe bundesweit einheitliche Regelungen für den schulischen Nachteilsausgleich – denn bis heute gibt es in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche oder gar fehlende Bestimmungen, besonders im Bereich Dyskalkulie. Auch in der Schweiz nutzen Politiker die Gelegenheit: 2022 etwa machte eine Nationalrätin öffentlich auf die Anliegen von Menschen mit Dyslexie und Dyskalkulie aufmerksam. Die Unterstützung durch prominente Fürsprecher und Entscheidungsträger verleiht dem Aktionstag zusätzliches Gewicht.
Gesellschaftliche und politische Schwerpunkte
Der Tag der Legasthenie und Dyskalkulie lenkt den Blick auf mehrere gesellschaftliche und bildungspolitische Kernfragen. Ein zentrales Thema ist die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Noch immer ist es in vielen Fällen Glückssache, ob ein Kind mit Legasthenie/Dyskalkulie die nötige Hilfe erhält. Die Verbände kritisieren, dass bisher keine flächendeckende Chancengleichheit erreicht wurde: In jedem Bundesland gelten teils andere schulrechtliche Regeln, und vielfach fehlen verbindliche Vorgaben zum Umgang mit Legasthenie und Dyskalkulie – oder sie enden nach der Grundschule. Besonders für rechenschwache Kinder (Dyskalkulie) gibt es in vielen Ländern bislang keine adäquaten Regelungen im Schulalltag. Diese Uneinheitlichkeit führt dazu, dass betroffene Schülerinnen und Schüler unterschiedlich behandelt werden und oft benachteiligt sind.
Ein weiteres Anliegen ist der Nachteilsausgleich in Prüfungen und bei Noten. Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit, bei diagnostizierter Legasthenie/Dyskalkulie bestimmte Nachteilsausgleiche zu gewähren (z. B. mehr Zeit oder angepasste Bewertungsmaßstäbe). Doch die Umsetzung ist nicht einheitlich geregelt und hängt vom Bundesland oder sogar der einzelnen Schule ab. Der BVL fordert daher gemeinsam mit Elterninitiativen, endlich verbindliche bundesweite Vorgaben einzuführen, damit alle betroffenen Kinder einen fairen Notenschutz erhalten – und nicht wie bislang mancherorts leer ausgehen.
Daneben macht der Aktionstag auf den generellen Mangel an Förderangeboten aufmerksam. Viele Schulen verfügen nicht über ausreichend geschulte Förderlehrkräfte oder Lerntherapeut*innen, um legasthene und dyskalkule Kinder gezielt zu unterstützen. In schweren Fällen müssen Eltern teure außerschulische Therapien organisieren, weil das Schulsystem keine individuellen Förderpläne vorsieht. Hier sprechen die Verbände von einem Fördernotstand und fordern mehr Ressourcen und Konzepte für die individuelle Förderung in der Schule. Laut dem Ersten Österreichischen Dachverband Legasthenie fehlen im gesamten deutschsprachigen Raum einheitliche Richtlinien zur Finanzierung solcher Förderungen – in Österreich können Eltern zwar theoretisch erhöhte Familienbeihilfe beantragen, in Deutschland springen manchmal Jugendämter ein, aber es gibt keine klare Regelung. Diese Lücken gilt es politisch zu schließen.
Auch die Lehrerausbildung und -fortbildung steht im Fokus. Viele Lehrkräfte fühlen sich unsicher im Umgang mit Lese-Rechtschreib- und Rechenschwächen, da das Thema in der Ausbildung oft zu kurz kommt. Verbände fordern, angehende Lehrer*innen besser zu sensibilisieren und im Dienst regelmäßige Fortbildungen anzubieten. Gut informierte Pädagogen können nämlich viel bewirken: Sie erkennen Anzeichen früher, gehen konstruktiv mit Fehlern um und passen ihre Notengebung an, wo es nötig ist. Der Aktionstag nutzt Vorträge, Lehrer-Webinare und Informationsmaterial, um genau hier anzusetzen und Wissen zu verbreiten.
Nicht zuletzt thematisiert der Tag der Legasthenie und Dyskalkulie die psychosozialen Folgen für Betroffene. Bleiben Lese- und Rechenstörungen unerkannt oder unbehandelt, sammeln die Kinder oft jahrelang Misserfolgserlebnisse. Dies führt zu Frustration, Schulangst, Verhaltensauffälligkeiten und einem negativen Selbstbild. Experten betonen, wie wichtig frühzeitige Hilfe ist, um ein „chronisches Scheitern“ zu verhindern. Der Aktionstag rückt daher die Früherkennung und Prävention in den Vordergrund. Eltern werden ermutigt, bei Verdacht früh Diagnostik zu veranlassen, und Schulen sollen schon in der Grundschule aufmerksam sein, wenn Kinder ungewöhnlich große Probleme mit Buchstaben oder Zahlen haben. Insgesamt steht der Appell im Raum, Legasthenie und Dyskalkulie nicht als Randthema, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen: Diese Kinder benötigen Verständnis und passende Unterstützung, damit sie ihr Potenzial entfalten können – davon profitieren letztlich auch Schulen, Ausbildungsbetriebe und die Gesellschaft als Ganzes.
Relevanz im deutschsprachigen Raum und international
In Deutschland hat der Tag der Legasthenie und Dyskalkulie innerhalb weniger Jahre große Bedeutung erlangt. Er wird inzwischen alljährlich von zahlreichen Institutionen aufgegriffen – von Ministerien und Schulbehörden bis hin zu Medien und Verbänden. So informieren zum Beispiel Bildungsserver, Schulportale und lokale Zeitungen rund um den 30. September über das Thema. Der Aktionstag hat es geschafft, das Thema Legasthenie/Dyskalkulie aus der Tabuzone zu holen und in die öffentliche Diskussion zu rücken. Durch die wiederkehrende Präsenz steigt die gesellschaftliche Sensibilisierung: Viele Eltern, Lehrkräfte und Mitschüler wissen heute besser über LRS und Rechenschwäche Bescheid als noch vor einigen Jahren. Zudem zeigt der 30. September Wirkung in der Politik – etwa durch regelmäßige Petitionen und Gespräche mit Entscheidungsträgern, wie die Intervention des BVL bei der Kultusministerkonferenz belegt.
In Österreich gibt es keinen eigenen national festgelegten „Tag der Legasthenie“ am 30. September, doch die Anliegen sind genauso relevant. Die österreichischen Legasthenie-Verbände und -Institutionen beteiligen sich vielfach an grenzübergreifenden Aktionen oder nutzen den Zeitraum rund um den deutschen Aktionstag für Öffentlichkeitsarbeit. So haben sich österreichische Lerntherapeutinnen dem deutsch initiierten Aktionstag angeschlossen und ihre besten Tipps online präsentiert. Generell engagiert sich der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) stark in der Aufklärung und Ausbildung von Spezialistinnen. In Österreich ist Legasthenie als Thema präsent – Schätzungen zufolge sind auch hier um die 5–10 % der Bevölkerung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten betroffen. Politisch gibt es in Österreich einige unterstützende Maßnahmen (beispielsweise die Möglichkeit einer erhöhten Familienbeihilfe für betroffene Kinder), doch auch hier fordern Eltern und Experten mehr Verbindlichkeit und einheitliche Lösungen. Der grenzüberschreitende Austausch – etwa über europäische Projekte oder via Social Media – sorgt dafür, dass die Anliegen der Legasthenie- und Dyskalkulie-Betroffenen auch in Österreich gehört werden. Immer wieder wird das Thema um den 30. September herum in Fachzeitschriften und Elternforen diskutiert und so die öffentliche Aufmerksamkeit hochgehalten.
In der Schweiz existiert ein vergleichbares Konzept: Dort begeht der Verband Dyslexie Schweiz (VDS) seit einigen Jahren einen Tag der Dyslexie und Dyskalkulie, allerdings meist im Oktober. So fand der Schweizer Aktionstag 2023 am 26. Oktober statt, 2024 und 2025 wurde er auf den 8. Oktober gelegt – offenbar in Anlehnung an den internationalen Dyslexie-Aktionstag (8. Oktober). An diesem Tag werden in der ganzen Schweiz sowie in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern verschiedene Veranstaltungen organisiert. Ziel ist es wie in Deutschland, Betroffenen zu zeigen, dass sie unterstützt und gehört werden und nicht alleine sind. Gleichzeitig kämpft der Verband Dyslexie Schweiz für offizielle Anerkennung von Legasthenie und Dyskalkulie im Bildungswesen. So fordert er etwa eine dyslexie- und dyskalkuliefreundliche Schul- und Berufslandschaft. Durch Medienmitteilungen (z. B. unter dem Motto „Chancengerechtigkeit für Betroffene jetzt!“) und Positionspapiere übt man Druck auf die Behörden aus, um einheitliche Regelungen und genügend Unterstützung sicherzustellen. In den letzten Jahren wurde in der Schweiz tatsächlich Fortschritte erzielt – unter anderem bestätigte ein Bundesgerichtsurteil das Recht auf Nachteilsausgleich, was einen Meilenstein für die Betroffenen darstellt. Der Aktionstag in der Schweiz trägt somit Früchte und erhöht die gesellschaftliche Akzeptanz von Legasthenie und Dyskalkulie.
Auch international gewinnt die Thematik an Aufmerksamkeit. In vielen Ländern werden im Oktober Schwerpunktwochen oder -monate durchgeführt, um auf Legasthenie aufmerksam zu machen. Die European Dyslexia Association (EDA) koordiniert beispielsweise die Dyslexia Awareness Week in der ersten vollen Oktoberwoche und bewirbt den 8. Oktober als World Dyslexia Day, der weltweit begangen wird. Insbesondere in den USA und Großbritannien gilt der Oktober als Dyslexia Awareness Month, in dem Kampagnen, rote Schriftzüge (“Go Red for Dyslexia”) und Aufklärungsevents üblich sind. Für Dyskalkulie etabliert sich allmählich ebenfalls ein internationaler Aktionstag: Die EDA hat den 3. März als Internationalen Dyskalkulie-Tag ausgerufen, um auch Rechenschwäche global ins Bewusstsein zu rücken. Diese weltweiten Initiativen stehen inhaltlich in Einklang mit dem Tag der Legasthenie und Dyskalkulie im deutschsprachigen Raum – überall geht es darum, Wissen zu teilen, Hürden abzubauen und betroffenen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Gesellschaft zu ermöglichen.