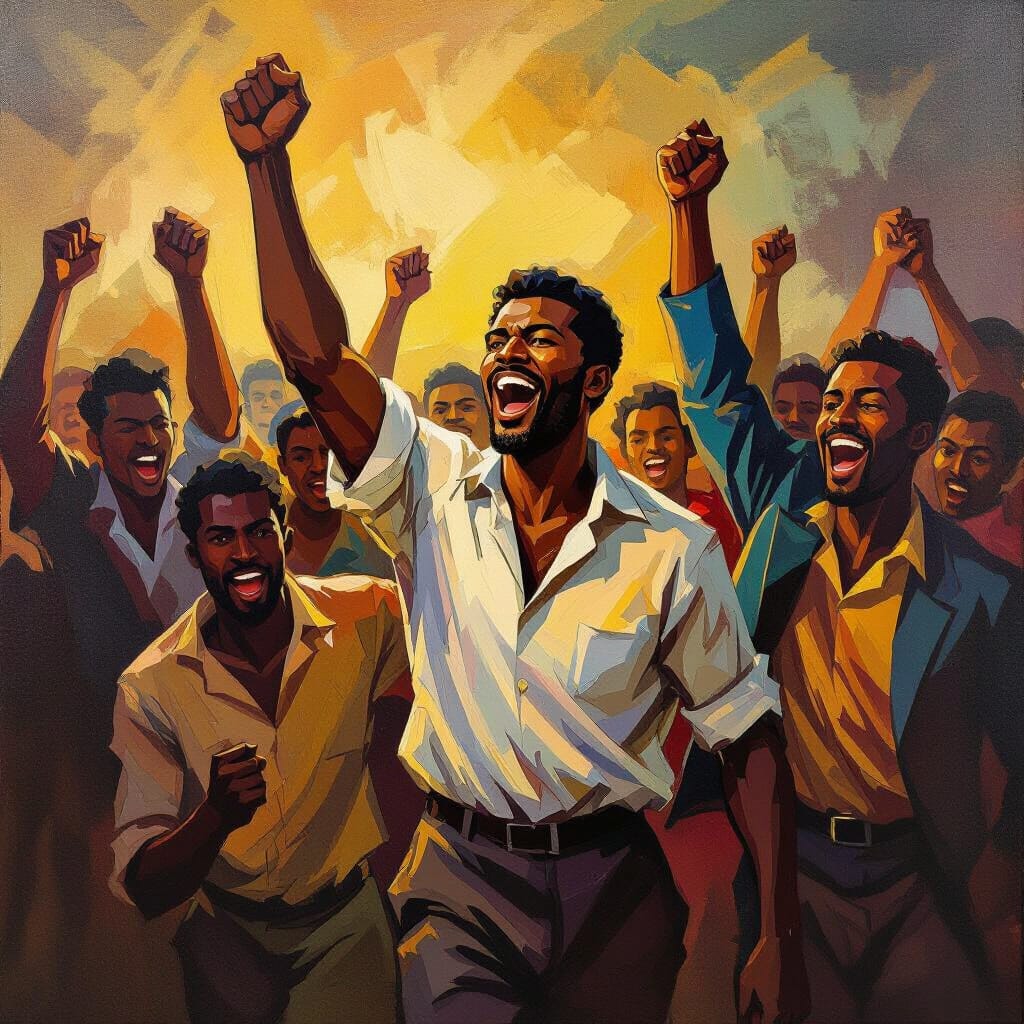Internationaler Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und dessen Abschaffung
Am 23. August wird weltweit der Internationale Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und dessen Abschaffung begangen. Dieser Gedenktag wurde 1998 von der UNESCO offiziell ins Leben gerufen, um an die Verbrechen des transatlantischen Sklavenhandels und deren Überwindung zu erinnern. Er soll die historische Tragödie der Sklaverei fest im globalen Gedächtnis verankern und der Opfer sowie ihrer Freiheitskämpfe gedenken. Zugleich mahnt der Aktionstag, aus der Vergangenheit zu lernen und gegen heutige Formen von Ausbeutung, Rassismus und Unrecht einzutreten.
Herkunft und historische Hintergründe
Die Wahl des Datums geht zurück auf einen Wendepunkt in der Geschichte der Sklaverei: In der Nacht vom 22. auf den 23. August 1791 begann in der französischen Kolonie Saint-Domingue (heute Haiti) ein Sklavenaufstand, der die Haitianische Revolution auslöste. Dieser erfolgreiche Aufstand führte 1804 zur Unabhängigkeit Haitis – dem ersten Staat der Welt, der von ehemaligen Versklavten gegründet wurde. Obwohl die Abschaffung der Sklaverei in anderen Teilen der Welt erst später und schrittweise erfolgte, markiert der Aufstand von 1791 symbolisch den Anfang vom Ende des transatlantischen Sklavenhandels.
Die UNESCO-Generalversammlung erklärte auf ihrer 29. Sitzung im November 1998 in Paris den 23. August offiziell zum internationalen Gedenktag. Schon zuvor wurde dieser Tag erstmals in Haiti (1998) und auf der Insel Gorée im Senegal (1999) mit Gedenkfeiern begangen. Gorée war einst ein zentraler Umschlagplatz des Sklavenhandels; das dortige „Haus der Sklaven“ steht heute als Mahnmal für die Millionen verschleppten Afrikaner. Insgesamt wurden zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert schätzungsweise über 12 Millionen afrikanische Männer, Frauen und Kinder gewaltsam als Sklaven nach Amerika verschifft – eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vor diesem Hintergrund initiierte die UNESCO bereits 1994 das Projekt „Der Weg der Sklaven“ (Slave Route Project), um die Geschichte des Sklavenhandels aufzuarbeiten und das Bewusstsein für dessen Ursachen und Folgen zu schärfen.
Bedeutung und Ziel des Aktionstages weltweit
Der Gedenktag am 23. August hat zum Ziel, das Bewusstsein für die Schrecken des Sklavenhandels und der Sklaverei zu schärfen und die Bedeutung ihrer Abschaffung hervorzuheben. Er bietet Gelegenheit, die historischen Gründe, Methoden und Konsequenzen dieser Tragödie zu beleuchten und die vielfältigen Beziehungen zwischen Afrika, Europa, Amerika und der Karibik infolge des Sklavenhandels zu analysieren. Die UNESCO formulierte dazu, man wolle „die Tragödie des Sklavenhandels in das kollektive Gedächtnis der Menschheit einschreiben“ und zugleich Raum für die Aufarbeitung der Geschichte schaffen. Dazu gehört auch, die Leistungen und kulturellen Beiträge der versklavten Menschen und ihrer Nachfahren zu würdigen, die trotz Unterdrückung maßgeblich die Geschichte und Entwicklung vieler Gesellschaften mitgeprägt haben.
Weltweit finden aus Anlass dieses Tages zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Bildungsaktivitäten statt. Die UNESCO ruft alle Mitgliedstaaten dazu auf, den Gedenktag mit Aktionen zu begehen und insbesondere junge Menschen, Pädagogen, Künstler und Intellektuelle einzubeziehen. Typische Aktivitäten am 23. August sind z. B.:
- Kranzniederlegungen und Zeremonien an historischen Orten der Sklaverei (etwa ehemaligen Sklavenburgen oder Hafenstädten des Sklavenhandels),
- Bildungsprogramme, Vorträge und Workshops in Schulen, Universitäten und Kulturzentren,
- Ausstellungen in Museen und Gedenkstätten zur Geschichte der Sklaverei,
- Kulturelle Veranstaltungen – Konzerte, Theateraufführungen, Filme oder Lesungen – die sich mit Sklaverei, Widerstand und Freiheitskämpfen auseinandersetzen.
Ein Beispiel für die gelebte Erinnerungskultur ist die britische Hafenstadt Liverpool, die einst stark in den Sklavenhandel involviert war. Dort wird der 23. August seit 1999 besonders begangen: Das International Slavery Museum in Liverpool – eröffnet am 23. August 2007 – widmet sich der Aufarbeitung dieser Vergangenheit, und ein jährlicher „Walk of Remembrance“ (Erinnerungsmarsch) führt zu historischen Stätten wie dem alten Sklavenschiff-Anleger im Hafen. Solche lokalen Initiativen verdeutlichen, wie der Gedenktag weltweit genutzt wird, um die eigene Geschichte kritisch zu betrachten und öffentliches Bewusstsein zu schaffen.
Bedeutend ist der Aktionstag nicht nur rückblickend, sondern auch mit Blick auf gegenwärtige Herausforderungen. Er erinnert uns daran, dass Sklaverei nicht vollständig der Vergangenheit angehört: Noch heute leben nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 50 Millionen Menschen in moderner Sklaverei oder sklavenähnlichen Verhältnissen – sei es als Opfer von Menschenhandel, Zwangsarbeit oder Zwangsheirat. Der 23. August ruft daher dazu auf, gegen moderne Formen der Sklaverei und Rassismus aktiv zu werden und die universellen Menschenrechte zu verteidigen. „Es ist an der Zeit, die Ausbeutung des Menschen ein für alle Mal abzuschaffen und die gleiche und unbedingte Würde jedes Einzelnen anzuerkennen“, erklärte UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay zum Gedenktag 2023, und forderte, aus dem Gedenken Kraft zu schöpfen, um gerechtere Gesellschaften für die Zukunft aufzubauen.
Relevanz in Deutschland: Gedenkkultur und Initiativen
Auch in Deutschland gewinnt die Erinnerung an Sklaverei und Kolonialismus zunehmend an Bedeutung, wenn auch der 23. August selbst hierzulande kein etabliertes Datum im öffentlichen Kalender ist. Offizielle Staatsakte zum UNESCO-Gedenktag sind selten; dennoch wird er von verschiedenen Institutionen und Initiativen aufgegriffen. Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen den Tag, um historische Aufklärung zu betreiben und aktuelle Bezüge herzustellen. So veröffentlicht etwa die Bundeszentrale für politische Bildung Hintergrundinformationen zu Sklaverei damals und heute, und entwicklungspolitische Netzwerke wie das Eine Welt Netz NRW stellen pädagogische Materialien bereit. Eine vom Eine-Welt-Netz konzipierte Wanderausstellung namens „Schwarz ist der Ozean“ informiert z. B. über den transatlantischen Sklavenhandel und seine fortwirkenden Folgen und kann von Schulen oder Bildungsträgern ausgeliehen werden. Solche Projekte sollen insbesondere junge Menschen für die Thematik sensibilisieren.
Historisch war Deutschland selbst zwar kein Hauptakteur des transatlantischen Dreieckshandels wie etwa Portugal, Großbritannien, Frankreich oder Spanien. Doch auch deutsche Akteure waren in begrenztem Umfang beteiligt: Händler im Dienste Brandenburg-Preußens unterhielten im 17. Jahrhundert an der westafrikanischen Küste die Kolonie Groß Friedrichsburg und handelten von dort aus mit versklavten Afrikanern. Schätzungen zufolge verschleppten die Brandenburger zwischen 1680 und 1717 bis zu 30.000 Menschen von Afrika in die Amerikas. Dieses Kapitel war lange ein blinder Fleck in der deutschen Geschichtsschreibung und Öffentlichkeit. Anders als die Verbrechen des Nationalsozialismus wurde der Kolonialzeit und dem Sklavenhandel im deutschen Erinnerungsdiskurs über Jahrzehnte wenig Platz eingeräumt.
Erst in jüngerer Zeit wächst das Bewusstsein für diese Vergangenheit, und in mehreren Städten und Bundesländern entstehen Initiativen zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Museen beginnen, koloniale Sammlungsstücke und ihre Provenienz kritisch zu hinterfragen; berühmte Beispiele sind die Rückgabe von geraubten Benin-Bronzen an Nigeria im Jahr 2022 oder die Anerkennung des deutschen Kolonialverbrechens an den Herero und Nama in Namibia als Völkermord. In der Öffentlichkeit wird vermehrt über kolonial belastete Straßennamen, Denkmäler und institutionellen Rassismus diskutiert. So hat Berlin jüngst damit begonnen, Straßennamen mit kolonialrassistischen Bezügen umzubenennen, und mehrere Städte (wie Hamburg, Berlin oder Leipzig) planen Kolonialmuseen bzw. Gedenkorte, um die eigene Beteiligung an kolonialer Ausbeutung – indirekt auch an Sklaverei – sichtbar zu machen.
Aktuelle Debatten: Erinnerungskultur, Rassismus und Gerechtigkeit
Die verstärkte Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte und Sklaverei führt in Deutschland zwangsläufig zu einer Neuaushandlung der Erinnerungskultur. Jahrzehntelang stand die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im Zentrum der deutschen Gedenkkultur – die Verbrechen von Kolonialismus und Sklavenhandel wurden demgegenüber deutlich weniger thematisiert. Dies beginnt sich zu ändern: Historiker, Politiker und Aktivisten diskutieren, wie die Erinnerung an koloniale Gewaltverbrechen angemessen in das bestehende Gedenken integriert werden kann, ohne die Singularität der Shoah infrage zu stellen. Es besteht Einigkeit, dass eine Erweiterung der Perspektiven nötig ist, um auch die Opfer von Sklaverei und Kolonialherrschaft im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Gerade Nachfahren der ehemals Kolonisierten – etwa Schwarze Deutsche (Afrodeutsche) – fordern, die Wurzeln des heutigen strukturellen Rassismus offenzulegen und aufzuarbeiten. Diese Forderungen traten insbesondere im Zuge der weltweiten Black Lives Matter-Proteste 2020 hervor, als verstärkt auf koloniale Kontinuitäten von Rassismus aufmerksam gemacht wurde.
Im Kontext dieser Debatten rückt auch die Frage nach historischer Gerechtigkeit in den Vordergrund. Weltweit wird zunehmend diskutiert, wie die Nachwirkungen von Jahrhunderten der Versklavung und kolonialen Ausbeutung ausgeglichen oder zumindest anerkannt werden können. Auf dem afrikanischen Kontinent und in der Karibik werden beispielsweise Reparationen für die historische Sklaverei eingefordert – die Rufe nach Wiedergutmachung werden global lauter. Im Jahr 2023 erkannten erstmals die Europäische Union und der lateinamerisch-karibische Staatenbund CELAC in einer gemeinsamen Erklärung an, dass der transatlantische Sklavenhandel ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Zwar bleibt offen, welche konkreten Maßnahmen daraus folgen, doch alleine diese Anerkennung stellt einen symbolisch wichtigen Schritt dar. In einigen ehemaligen Kolonialmächten gibt es ebenfalls ein Umdenken: So hat der niederländische König Willem-Alexander im Jahr 2023 offiziell um Verzeihung für die Sklaverei-Vergangenheit der Niederlande gebeten. In Großbritannien engagieren sich sogar Nachfahren einstiger Sklavenhändler persönlich dafür, finanzielle Wiedergutmachung zu leisten.
In Deutschland fokussieren sich politische Diskussionen im Bereich koloniales Erbe bislang eher auf die Anerkennung und Aufarbeitung von Verbrechen im einstigen deutschen Kolonialreich (etwa in Namibia, Tansania oder Kamerun). Dennoch sind diese Diskussionen eng mit dem Gedenken an den Sklavenhandel verknüpft, denn beide betreffen die historische Verantwortung Europas gegenüber ehemaligen Kolonialgesellschaften. Die deutsche Bundesregierung betont heute, dass eine lebendige Erinnerungskultur Rassismus und Diskriminierung entgegenwirken muss und alle Teile der Gesellschaft einschließen soll. Dazu gehört auch, den Beitrag von Menschen afrikanischer Herkunft in der Geschichte sichtbar zu machen und gegen fortdauernde Ungerechtigkeiten – von ungleichen Wohlstandsverhältnissen bis hin zu rassistischer Gewalt – anzugehen. Der Gedenktag am 23. August setzt hier ein deutliches Zeichen: Er erinnert nicht nur an die Vergangenheit, sondern mahnt zu Solidarität, Empathie und globaler Gerechtigkeit in der Gegenwart.