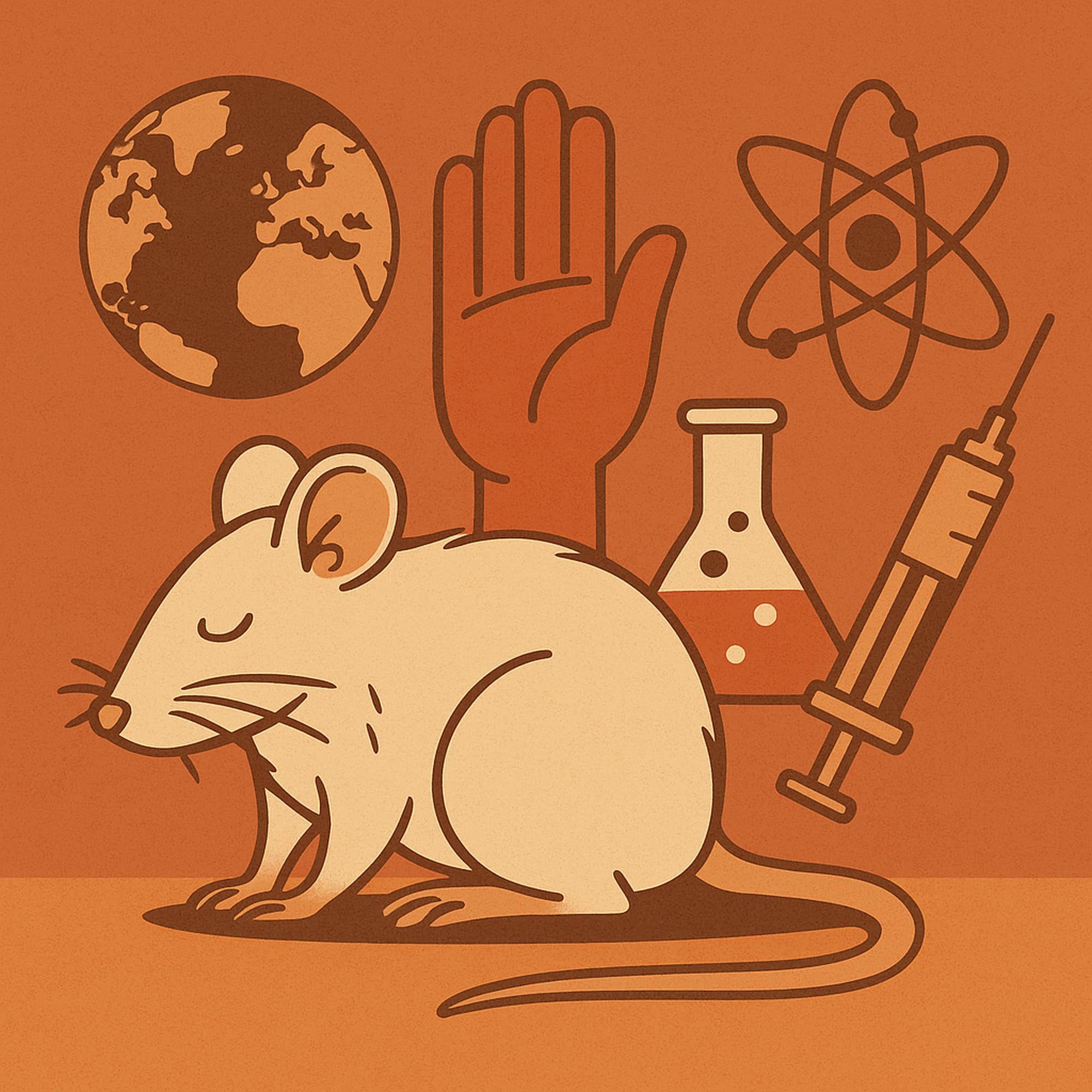24. April
Internationaler Tag zur Abschaffung von Tierversuchen in Deutschland
Ursprung und Etablierung des Aktionstags in Deutschland
Der Internationale Tag zur Abschaffung von Tierversuchen findet jährlich am 24. April statt. Ins Leben gerufen wurde er bereits 1962 von der britischen Tierschützerin Lady Muriel Dowding, die damit auf das Schicksal der unzähligen Versuchstiere aufmerksam machen wollte. Die Wahl des Datums geht auf den 24. April als Geburtstag ihres Ehemannes Lord Hugh Dowding zurück, der sich im britischen Oberhaus für Tierschutz einsetzte. 1979 erklärte die National Anti-Vivisection Society (NAVS) in Großbritannien diesen Tag dann offiziell zum „World Day for Laboratory Animals“ (Weltlabortiertag). Ziel des Aktionstags ist es seither, auf die Millionen von Tieren aufmerksam zu machen, die jedes Jahr weltweit zu wissenschaftlichen Zwecken in Experimenten genutzt werden.
In Deutschland wurde der Gedenktag erst später übernommen und bekam hier seine heutige Bezeichnung. Verschiedene deutsche Tierrechtsorganisationen übersetzten den englischen Namen zunächst uneinheitlich. Ärzte gegen Tierversuche e.V., ein deutscher Verein von tierversuchskritischen Wissenschaftlern, prägte im Jahr 2007 erstmals den Begriff „Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche“. Seit 2013 dokumentiert dieser Verein jährlich alle größeren Aktionen rund um den Aktionstag in Deutschland, was zeigt, dass der Gedenktag mittlerweile fest im Kalender der deutschen Tierschutz- und Tierrechtsbewegung verankert ist. Allerdings verwenden Einrichtungen und Befürworter von Tierversuchen mitunter eine andere Bezeichnung: In Forschungskreisen spricht man auch vom „Tag des Versuchstiers“, um den Fokus eher auf das Tierwohl im Rahmen bestehender Versuche (etwa durch das 3R-Prinzip: Replace, Reduce, Refine) zu legen, statt auf die Forderung nach vollständiger Abschaffung. Tierschutzorganisationen hingegen betonen mit der gewählten Bezeichnung unmissverständlich das Ziel, Tierversuche gänzlich zu überwinden.
Gesellschaftliche und politische Bedeutung
Der Aktionstag hat in Deutschland eine wichtige gesellschaftliche und politische Bedeutung, da er jedes Jahr die kontroverse Diskussion um Tierversuche ins öffentliche Bewusstsein rückt. Meinungsumfragen zeigen, dass eine große Mehrheit der Deutschen Tierversuche kritisch sieht: Über drei Viertel der Bevölkerung sind besorgt über die Verwendung von Tieren in Forschung und Lehre und fordern verstärkte Anstrengungen, um Tierversuche durch andere Methoden zu ersetzen. So gaben z.B. 84 % der Befragten in einer EU-weiten Umfrage an, die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten sollten eine koordinierte Strategie zum vollständigen Ersatz von Tierversuchen entwickeln. Diese öffentliche Stimmung verleiht dem Aktionstag Nachdruck – er dient als Anlass, politischen Druck auf Entscheidungsträger auszuüben.
Tatsächlich mahnen deutsche Tierschutzverbände an diesem Tag regelmäßig die Politik zum Handeln. Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte etwa den „anhaltenden politischen Stillstand in Sachen Tierversuche in Deutschland“ als „beschämend“ und forderte die Bundesregierung auf, ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen – insbesondere eine Gesamtabstiegs- oder Reduktionsstrategie für Tierversuche vorzulegen und alternative Forschungsmethoden stärker zu fördern. Im derzeitigen Koalitionsvertrag der Bundesregierung (SPD, Grüne, FDP) ist die Erarbeitung einer Reduktionsstrategie zwar ausdrücklich vereinbart, konkrete Ergebnisse ließen jedoch lange auf sich warten. Tierschützer verweisen darauf, dass eine solche Strategie überfällig ist, zumal Deutschland im europäischen Vergleich noch immer das Land mit den höchsten Versuchstierzahlen ist. Erst Ende 2023 kündigte das zuständige Bundesministerium offiziell an, eine nationale Reduktionsstrategie vorzulegen; Tierschutzorganisationen drängen darauf, diese Pläne zügig in die Tat umzusetzen.
Auch auf EU-Ebene gewinnt das Thema an Bedeutung. Eine europäische Bürgerinitiative unter dem Motto „Save Cruelty Free Cosmetics – Für ein Europa ohne Tierversuche“ sammelte 2022/23 über 1,2 Millionen Unterschriften von EU-Bürgerinnen und -Bürgern. Darin wird nicht nur der Erhalt des Kosmetik-Tierversuchsverbots gefordert, sondern eine gesamte Abkehr von Tierversuchen und die Modernisierung der Wissenschaft. Das erfolgreiche Anliegen unterstreicht, dass die Gesellschaft – sowohl in Deutschland als auch europaweit – einen Paradigmenwechsel hin zu tierversuchsfreier Forschung erwartet. Im politischen Raum werden diese Forderungen teils aufgegriffen, teils stoßen sie aber auch auf Widerstand aus der Forschungs-Lobby, was etwa an gesetzlichen Vorstößen sichtbar wird: So sorgten Pläne einer politischen Koalition (CDU/CSU und SPD) für Aufsehen, Versuchstiere aus dem Geltungsbereich des Tierschutzgesetzes herauszulösen und in einem eigenen „Innovationsfreiheitsgesetz“ zu regeln. Tierschutzverbände warnten, dies käme einer Abschwächung des Tierschutzes gleich – mit Verweis auf Österreich, wo ein separates Tierversuchsgesetz deutlich schlechtere Haltungsbedingungen erlaubt und Tierschutzklagen erschwert. Diese Debatte zeigt, dass der Konflikt zwischen Forschungsfreiheit und Tierschutz nach wie vor hochaktuell ist und am Aktionstag verstärkt öffentlich diskutiert wird.
Engagement und Aktionen zum Gedenktag in Deutschland
Rund um den 24. April entfaltet sich in Deutschland jedes Jahr ein breites Engagement von Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen. Zahlreiche anerkannte Verbände – darunter PETA Deutschland, die Albert Schweitzer Stiftung, Animal Rights Watch (ARIWA), Ärzte gegen Tierversuche, Menschen für Tierrechte, die Stiftung Vier Pfoten, TASSO sowie die Tierschutzpartei – beteiligen sich mit Aktionen und Informationskampagnen am Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche. Sie alle eint das Ziel, auf das Leid der Versuchstiere aufmerksam zu machen und politischen wie gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen.
Typische Aktionen an diesem Gedenktag sind Protestkundgebungen, Mahnwachen, Infostände und Demonstrationen in vielen Städten. So organisieren PETA und ihre lokalen „Street Teams“ im April – dem „Aktionsmonat“ rund um den 24.4. – in zahlreichen deutschen Städten regelmäßig öffentliche Aktionen, um Mitgefühl für Tiere zu wecken und über Tierversuche aufzuklären. Dabei werden Passant*innen beispielsweise mit Bannern, Flugblättern, Mahnmal-Installationen oder Straßentheater auf die Thematik aufmerksam gemacht. Häufig rufen die Organisationen die Bevölkerung auch dazu auf, Petitionen zu unterzeichnen oder selbst aktiv zu werden, etwa indem man nur tierversuchsfrei hergestellte Produkte kauft oder Hochschulen auffordert, tierversuchsfreie Lehrmethoden einzusetzen. Viele Kampagnen werden von begleitender Presse- und Öffentlichkeitsarbeit flankiert – so veröffentlichen Verbände am 24. April Pressemitteilungen, in denen sie aktuelle Missstände anprangern oder politische Forderungen erheben.
Nicht nur NGOs, sondern auch staatliche Stellen nehmen den Aktionstag zum Anlass für Veranstaltungen. Beispielsweise lud die Berliner Landestierschutzbeauftragte am 24. April 2023 zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit Wissenschaftler:innen ein, um der Frage nachzugehen, wie Tierversuche zügig durch human-relevante Methoden ersetzt werden können. An solchen Diskussionen nehmen sowohl Experten für tierversuchsfreie Verfahren als auch Vertreter der Forschung teil, um Lösungen zu erörtern. Dieses Zusammenspiel von Protestaktionen, Bildungsarbeit und Dialog verdeutlicht, wie der Gedenktag hierzulande begangen wird: als bundesweiter Aktionstag, der Bürger, Wissenschaft und Politik gleichermaßen adressiert, um den Ausstieg aus dem Tierversuch voranzutreiben.
Rechtlicher Rahmen für Tierversuche in Deutschland
In Deutschland sind Tierversuche streng reguliert. Die zentralen Vorschriften finden sich im Tierschutzgesetz (TierSchG) sowie in der Tierschutz-Versuchstierverordnung (TierSchVersV), die die EU-Tierversuchsrichtlinie 2010/63/EU ins nationale Recht umsetzt. Grundsätzlich gilt seit 2002 der Staatszielartikel 20a im Grundgesetz, welcher dem Staat den Schutz der Tiere als Verfassungsauftrag auferlegt. Dieser hohe Rang des Tierschutzes spiegelt sich im einfachen Gesetz wider: §1 TierSchG formuliert, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf.
Tierversuche sind nur erlaubt, wenn sie unerlässlich sind und ethisch vertretbar erscheinen. Das Gesetz definiert in §7a TierSchG detailliert, unter welchen Voraussetzungen ein Tierversuch als „unerlässlich“ gilt – etwa zur Grundlagenforschung, zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten bei Mensch oder Tier, oder zur Sicherheitsprüfung von Arzneimitteln und Chemikalien. Eine unabdingbare Bedingung ist dabei, dass kein alternatives Verfahren zur Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellung zur Verfügung steht. Gibt es verlässliche tierversuchsfreie Methoden, so müssen diese laut Gesetz zwingend anstelle des Tierversuchs angewendet werden. Dadurch soll dem 3R-Prinzip (Replace – Ersetzen, Reduce – Verringern, Refine – Verbessern) Rechnung getragen werden, das auch in Deutschland Leitlinie für den Umgang mit Versuchstieren ist.
Experimente an Wirbeltieren und Kopffüßern dürfen nur nach vorheriger behördlicher Genehmigung durchgeführt werden. Jeder Forscher, der einen Tierversuch plant, muss einen umfangreichen Antrag bei der zuständigen Landesbehörde einreichen. In diesem Antrag sind u.a. anzugeben: Zweck und Notwendigkeit des Versuchs, die genaue Versuchsbeschreibung, die Anzahl und Art der Tiere, sowie eine Begründung, warum keine Alternativmethoden eingesetzt werden können. Ebenso muss dargelegt werden, dass das erwartete Wissen den Tieren zugemutete Schmerzen oder Leiden aufwiegt, der Versuch also „ethisch vertretbar“ ist. Jeder Antrag wird von einer unabhängigen Tierversuchskommission (bestehend aus Fachleuten und Tierschutzvertretern) begutachtet; die Behörde erteilt die Genehmigung nur, wenn die gesetzlichen Kriterien strikt erfüllt sind. Überdies muss jede Einrichtung, die mit Tieren forscht, einen Tierschutzbeauftragten bestellen, der die Einhaltung der Vorschriften überwacht und die Wissenschaftler in Fragen des Tierschutzes berät. Verstöße gegen Auflagen oder illegale Tierversuche können mit Bußgeldern bis 25.000 € oder sogar Freiheitsstrafen geahndet werden.
Das Tierschutzgesetz verbietet einige Tierversuche ausdrücklich. Untersagt sind Versuche zu trivialeren Zwecken, etwa zur Entwicklung von Tabakerzeugnissen, Waschmitteln, Kosmetika sowie von Waffen und Munition. In der EU sind Tierversuche für Kosmetika seit 2013 komplett verboten; allerdings bemängeln Tierschützer Schlupflöcher, da manche Inhaltsstoffe als Chemikalien dennoch an Tieren getestet werden müssen. Strenge Einschränkungen gelten auch für bestimmte Tierarten: So dürfen Menschenaffen faktisch nicht mehr in Versuchen eingesetzt werden (ausgenommen äußerste Ausnahmefälle), und für Primaten insgesamt gelten hohe Hürden und spezielle Rechtfertigungen. Generell schreibt der rechtliche Rahmen vor, Schmerzen und Belastungen für Versuchstiere so gering wie möglich zu halten – etwa durch Schmerzmittel, optimalen Haltungskomfort und das frühzeitige Beenden von Versuchen bei schweren Leiden. Nach Abschluss eines Experiments sind die Tiere im Regelfall schmerzlos zu töten, es sei denn, sie können ohne Leid am Leben erhalten und weitervermittelt werden.
Aktuell befindet sich der Rechtsrahmen in einem Spannungsfeld zwischen Tierschutz und Forschungsinteressen. Einerseits mahnt die EU-Kommission die Mitgliedstaaten, die Richtlinienvorgaben strikter umzusetzen und vermehrt Alternativen zu fördern; andererseits fordern manche Forschende deregulierte Maßnahmen. In Deutschland löste der Vorschlag, ein eigenes Tierversuchs-Gesetz außerhalb des Tierschutzgesetzes zu schaffen, massive Kritik aus. Tierschutzverbände befürchten im Falle einer Ausgliederung der „Versuchstiere“ aus dem allgemeinen Tierschutzrecht erhebliche Verschlechterungen für Labortiere – z. B. schlechtere Haltungsstandards, erleichterte Genehmigungen und weniger Kontrollmöglichkeiten für Tierschützer. Aufgrund des Verfassungsranges des Tierschutzes (Artikel 20a GG) gilt zudem eine Verschlechterung des Schutzstatus als rechtlich fragwürdig. Dieses Beispiel zeigt, dass die rechtliche Ausgestaltung von Tierversuchen weiterhin umkämpft ist. Der Internationale Aktionstag dient hierbei als wichtiger Gradmesser: Forderungen nach Reformen – sei es strengeren Gesetzen oder einem verbindlichen Ausstiegsplan – werden an diesem Tag besonders deutlich artikuliert.
Statistische Daten und aktuelle Entwicklungen in Deutschland
Deutschland veröffentlicht jährlich detaillierte Tierversuchsstatistiken, die Aufschluss über Umfang und Art der durchgeführten Versuche geben. In den letzten Jahren ist ein leichter Abwärtstrend erkennbar: 2022 wurden insgesamt rund 1,73 Millionen Wirbeltiere und Kopffüßer in genehmigungspflichtigen Tierversuchen eingesetzt – etwa 134.000 Tiere bzw. 7 % weniger als im Vorjahr. Bereits in den beiden Jahren zuvor waren die Zahlen rückläufig, sodass 2022 das dritte Jahr in Folge mit einem Rückgang markierte. Als mögliche Gründe nennt das Bundesinstitut für Risikobewertung das zunehmende Durchsetzen von Alternativmethoden und Reduktionsmaßnahmen in der Forschung. Dennoch nimmt Deutschland im EU-Vergleich weiterhin einen Spitzenplatz ein, was die absolute Zahl eingesetzter Versuchstiere betrifft.
Bemerkenswert ist, dass seit 2021 auch jene Tiere erfasst werden, die zwar für Versuche gezüchtet, letztlich aber nicht verwendet und dennoch getötet wurden. Diese bisher oft unberücksichtigt gebliebenen Tiere machen die tatsächliche Dimension der Tiernutzung deutlich. So wurden im Jahr 2022 neben den 1,73 Mio. tatsächlich in Experimenten verwendeten Tieren zusätzlich etwa 711.000 Tiere getötet, um Organe oder Gewebe für wissenschaftliche Zwecke zu entnehmen. Hinzu kamen rund 1,77 Millionen überzählige Zuchttiere, die für wissenschaftliche Zwecke getötet wurden, ohne je in einem Versuch zum Einsatz gekommen zu sein – diese Zahl lag zwar deutlich unter dem Vorjahreswert (2021: 2,55 Mio., –31 %), ist aber immer noch sehr hoch. Insgesamt starben 2022 über 4,2 Millionen Tiere im Zusammenhang mit Tierversuchen in Deutschland. Diese Zahl umfasst also sowohl die direkt in Versuchen verwendeten als auch die indirekt für die Wissenschaft „verbrauchten“ Tiere. Tierschützer sehen darin einen dringenden Handlungsauftrag an die Politik, dieses Ausmaß durch bessere Planung (weniger Überschusstiere) und Förderung moderner Methoden drastisch zu verringern.
Ein Blick auf die Verwendungszwecke der Tierversuche zeigt, wofür in Deutschland hauptsächlich Tiere eingesetzt werden. Laut Statistik dienen rund 55 % aller Tierversuche der Grundlagenforschung, d. h. der reinen Wissensmehrung über biologische Vorgänge. Etwa 14 % entfallen auf die angewandte Forschung zu Krankheiten bei Menschen oder Tieren (z. B. Erforschung von Krebs, neurologischen oder infektiösen Erkrankungen). Weitere 16 % der Tiere werden für behördlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen und die Herstellung bzw. Qualitätskontrolle von medizinischen Produkten eingesetzt – hierzu zählen z. B. Tests zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Medikamenten oder Chemikalien. Rund 11 % der Tiere werden benötigt, um Zuchtkolonien genetisch veränderter Linien aufrechtzuerhalten. Die restlichen ca. 4 % verteilen sich auf sonstige Zwecke wie den Artenschutz, die Aus- und Weiterbildung oder Umweltschutzforschung.
Betrachtet man die Forschungsschwerpunkte innerhalb der Grundlagenforschung, so lagen 2022 vor allem Untersuchungen auf den Gebieten Neurobiologie und Immunologie vorn – etwa 21 % der Grundlagentierversuche betrafen das Nervensystem und 19 % das Immunsystem der Tiere. Weitere häufig untersuchte Bereiche waren das kardiovaskuläre System (~13 %) sowie multi-systemische Fragestellungen (~12 %). In der angewandten biomedizinischen Forschung stand 2022 insbesondere die Krebsforschung im Mittelpunkt – rund 42 % der hierfür eingesetzten Versuchstiere wurden für onkologische Studien verwendet. Auch Forschungen zu Infektionskrankheiten (ca. 10 %) und neurologischen Erkrankungen (ca. 12 %) bei Menschen nahmen einen nennenswerten Anteil ein. Diese Zahlen verdeutlichen, dass medizinische Fragestellungen einen Großteil der Tierversuche motivieren – Kritiker bemängeln jedoch, dass viele Ergebnisse aus Tierexperimenten nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar sind und somit zweifelhaften Nutzen haben.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass die absolute Zahl der Tierversuche in Deutschland noch immer hoch ist, jedoch einen leichten Rückgang zeigt. Die öffentliche und politische Diskussion – gerade auch befeuert durch den Aktionstag am 24. April – zielt darauf ab, diesen Trend zu verstärken. Ein wichtiges Signal in diesem Zusammenhang ist die angekündigte bundesweite Reduktionsstrategie: Die Bundesregierung hat versprochen, einen Fahrplan zur Reduzierung von Tierversuchen vorzulegen und die Förderung tierversuchsfreier Verfahren auszubauen. Tierschutzorganisationen mahnen an, dass es nicht bei Ankündigungen bleiben dürfe – die hohe Zahl von über vier Millionen jährlich getöteten Versuchstieren zeige, dass entschlossenes Handeln notwendig ist. Perspektivisch wird daher gefordert, konkrete Ausstiegsziele zu formulieren und Forschungsfördermittel verstärkt in moderne In-vitro- und In-silico-Methoden (Zellkulturen, Organoide, Computersimulationen etc.) zu lenken. Der Internationale Tag zur Abschaffung von Tierversuchen spielt dabei eine zentrale Rolle, um jährlich Bilanz zu ziehen, Fortschritte hervorzuheben und zugleich daran zu erinnern, wie viel noch zu tun bleibt, bis das Leid der Versuchstiere endgültig der Vergangenheit angehört.